Die Besiedlung des Martelltals ist ab dem 11. Jahrhundert im Zuge der hochmittelalterlichen Höhenkolonisation organisiert worden. Chroniken zeigen, dass um 1340 bereits eine Gemeinde Martell existierte.
Diese Besiedlung bedeutete, dass bisher nur saisonal oder sporadisch benutzte Almgebiete in ganzjährig bewohnte Schwaighöfe umgewandelt wurden. Die Bauern wurden für die Schwierigkeiten bei der Urbarmachung mit dem Erbbaurecht belohnt. Damit wurde die im Hochmittelalter einsetzende Bevölkerungszunahme ausgeglichen und übervölkerte Zonen wurden entlastet. Der Hofname Greit lässt sich auf eine solche Rodung zurückführen.
Siedlungsschübe hat es nach zwischenzeitlichen Entvölkerungen in Pestzeiten gegeben sowie ab dem 15. Jahrhundert durch Bergknappen, die anfänglich privat leicht zugängliche Lagerstätten ausbeuteten. Um 1650 holten die Grafen Hendl gut ausgebildete Knappen aus Schwaz.
Nicht alle Bergknappen verließen nach Auflassen der Schürftätigkeiten um 1800 das Martelltal. Viele blieben mangels Alternativen als verarmte und verachtete Kleinhäusler und verdienten sich durch handwerkliche Tätigkeiten wie Korbflechten, Drechseln oder als Fassbinder neben den Tätigkeiten als Tagelöhner auf den Bauernhöfen ein Zubrot.
1427 existierten in Martell 50 Haushalte. 1847 wurden erstmalig 1000 Einwohner gezählt.

 Bergbau Bergbau
1448 wird der Bergbau in Martell das erste Mal urkundlich erwähnt. Im Laufe der Zeit wurde an vielen Stellen im Tal geschürft. Viele eingestürzte Stollen zeugen davon. Die ergiebigsten Lagerstätten lagen in den Saltgräben und im Pedertal.
Erst mit der Schaffung eines eigenen Tiroler Bergbauamtes in Imst um 1540 wurde der wilde Abbau Regeln unterworfen. Ab 1650 ließen die Grafen Hendl aus dem Vinschgau die Gebiete um Latsch, Morter, Goldrain und Martell systematisch nach Erzlagerstätten absuchen. Erbeutet wurde Kupfer, Eisen und Silber.
Die Erze wurden in Stampfwerken und Schmelzhütten in Morter, in Ennewasser und in der Schmelz verarbeitet. In der angeblichen Goldgrube im Pedertal, um die sich im Volksmund hartnäckig die abenteuerlichsten Gerüchte ranken, wurden bei Probegrabungen 1910 Kupfer, Eisen und Schwefel, aber kaum Gold gefunden.
Für die seelsorgerische Betreuung der Bergknappen ließen die Grafen Hendl 1711 in der Schmelz eine Kapelle errichten, die 1894 im neugotischen Stil erneuert wurde.
Die Schürftätigkeiten dauerten bis 1800. Die alte Gruebhütte wurde in den 1930er Jahren von jener Gesellschaft angekauft, die das Hotel Paradies erbaute. Daraus wurde das Schutzhaus Borromeo.
Die Marteller Bevölkerung selbst hatte vom Bergbau kaum einen wirtschaftlichen Nutzen.
 Erster und zweiter Weltkrieg Erster und zweiter Weltkrieg
Im Ersten Weltkrieg verlief die Front ab dem Mai 1915 auf den damals noch stärker vergletscherten Bergkämmen des Cevedale. Eine etwa 700 Mann zählende Besatzung war auf Zufall stationiert. Ein Relikt dieser Zeit ist eine von den Soldaten erbaute Kapelle auf Zufall.
Immer wieder gab es Gerüchte über eine Evakuierung der Einwohner. Wie für die gesamte Südtiroler Bevölkerung waren die Angliederung Südtirols an Italien und die danach folgenden Maßnahmen der faschistischen Verwaltung auch für die Marteller bedrückend und entmutigend. Bei der Option 1939 optierten von den 1175 Einwohnern 1100 für Deutschland. Vor Ausbruch des Krieges wanderten 290 von ihnen, vorwiegend Besitzlose und Dienstboten, aus.
Der von der italienischen Regierung 1935 eingeführte Nationalpark Stilfser Joch versetzte die Bergbewohner in große Angst, weil sie dadurch eine schwere Beeinträchtigung ihrer bisherigen Lebens- und Wirtschaftsweise befürchteten.
 Muren, Gletscherseeausbrüche, Flutwellen Muren, Gletscherseeausbrüche, Flutwellen
Durch das im 19. Jahrhundert viel stärker vergletscherte Einzugsgebiet waren nicht nur Starkregen oder Schneeschmelze die Ursachen für Murenabgänge. Die oft unbemerkt heranwachsenden Gletscherseen jagten nach ihrem Ausbruch gewaltige Wellen durch das Tal. Bauwerke, Wege und Brücken wurden mitgerissen.
Im August 1987 hatten ungewöhnlich starke Regenfälle landesweit zu Vermurungen geführt. Auch im Martelltal waren die Regenmengen enorm und hatten den Zufritt-Stausee bis an den Rand gefüllt. Der (gegen die Vorschriften) allein arbeitende Schleusenwärter öffnete auf Befehl seiner Vorgesetzten in der Nacht die Tore desStausees, um Wasser abzulassen. Technische Probleme – angeblich auch ein Stromausfall – verhinderten die Schließung der Schleusen während der folgenden Stunde. Eine Flutwelle schoss talwärts, riss in der Gemeinde Martell 16 Häuser mit sich und zog eine Spur der Verwüstung bis in die Latscher Industriezone.
Trotz der gewaltigen Schäden gab es überraschenderweise weder Verletzte noch Tote. Die Einwohner konnten gerade noch rechtzeitig evakuiert werden. Die Kraftwerksgesellschaft wurde für schuldig befunden, diese Katastrophe mit verursacht zu haben.

 Sakralbauten Sakralbauten
Vermutet wird die Existenz einer Walpurga-Kapelle um 1203. Die Walpurgiskirche, die ursprünglich romanisch war, wurde mehrmals – zuletzt 1759 – umgebaut.
In der Schmelz, bei der Hintermartell beginnt, standen früher Gebäude und Schmelzöfen für die Erzgewinnung. 1911 wurde die Kapelle St. Maria in der Schmelz für die Bergknappen erbaut.
Auf Zufall waren es Soldaten im Ersten Weltkrieg, die dort die Kapelle errichteten.
 Das Hotel Paradiso del Cevedale Das Hotel Paradiso del Cevedale
Hinter dem Stausee steht auf einer Meereshöhe von 2.160 m eine Bauruine, das ehemalige Luxushotel Paradiso, das zwischen 1933 und 1935 auf Initiative des faschistischen italienischen Fremdenverkehrsministeriums von einer Aktiengesellschaft erbaut worden war.
Der für die Umgebung ungewöhnliche Stil, bei dem der Architekt Elemente des Novecento und der Moderne verband, sollte dem Geschmack der Führer des Finanz- und Industriesektors sowie der faschistischen Parteigrößen entsprechen. So erfolgte hier eine Stein gewordene Machtdemonstration der Italianità und des neuen Regimes. Die Marteller mochten das Hotel von Beginn an nicht, weil ihre Kühe dort nicht mehr weiden durften.
Das Sport- und Luxushotel mit Rundumversorgung (250 Betten, Post, Telegraphenamt, Friseur, Masseur, Skilehrer, Sauna ...) für betuchte Gäste durfte sich nur einer kurzen Blüte erfreuen. Im Winter fanden sich hier bevorzugt deutsche und im Sommer italienische Gäste ein.
1943 wurde das Hotel Paradiso von der Deutschen Wehrmacht belegt und diente als Urlaubsstützpunkt für Soldaten (z.B. für Angehörige der Division Brandenburg nach der Befreiung Mussolinis).
Obwohl sich das Hotel gleich nach dem Zweiten Weltkrieg eines regen Gästeaufkommens erfreute, ging es 1946 in Konkurs. 1952 erwarb es der venezianische Reeder Benati, ließ den ehemals grünen Bau rot streichen und erweiterte das Hotel durch verschiedene Zubauten. 1955 änderte Benati seine Pläne und überließ das Hotel in unfertigem Zustand seinem Schicksal. Es wurde anschließend all seines Inventars beraubt. 1966 wurde der Komplex von den Eignern der Brauerei Forst erworben.
Siehe auch > Geschichte Südtirols
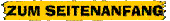
|



